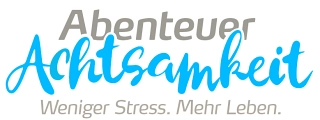Achtsamkeit und Inquiry
Achtsamkeit, oft als bewusste, unvoreingenommene und offene Wahrnehmung des gegenwärtigen Moments definiert, hat in den letzten Jahren sowohl in der Forschung als auch in der Praxis an Bedeutung gewonnen. Inquiry, als Teil der Achtsamkeitspraxis, bezieht sich auf den Prozess der Selbstbefragung und Reflexion, der oft in Achtsamkeitsprogrammen wie MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) und MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) integriert ist.
Merkmale des Inquiry in der Achtsamkeitspraxis
Interaktive Inquiry-Prozesse: In der Achtsamkeitspraxis, insbesondere in MBSR und MBCT, spielt Inquiry eine zentrale Rolle. Es handelt sich um einen interaktiven Prozess, der nach geführten Meditationen stattfindet und durch Fragen und Reformulierungen gekennzeichnet ist. Dieser Prozess fördert die Entwicklung von Fähigkeiten zur Beschreibung von Erfahrungen und schafft eine intersubjektive Verbindung innerhalb der Gruppe (Crane et al., 2014).
Selbstbefragung und künstlerische Praxis: Inquiry kann auch in künstlerischen Praktiken integriert werden, um tiefere persönliche Einsichten zu gewinnen. In einer Studie mit Kunstpädagogik-Studenten wurde untersucht, wie Achtsamkeit und Selbstbefragung die künstlerische Praxis beeinflussen können. Diese Praktiken können zu einem besseren Verständnis von Achtsamkeit und ihrer Anwendung in sozialen und kulturellen Strukturen führen (Graham & Lewis, 2020).
Neurokognitive Perspektiven
Neuroplastizität und Interozeption: Achtsamkeit und Inquiry sind eng mit neurokognitiven Prozessen verbunden, insbesondere mit der Interozeption, die durch die Insula im Gehirn vermittelt wird. Diese Prozesse fördern die neuroplastischen Veränderungen, die mit der Achtsamkeitspraxis einhergehen, und tragen zur Entwicklung einer dispositionalen Achtsamkeit bei (Gibson, 2019).
Neurale Mechanismen der Achtsamkeit: Studien zeigen, dass Achtsamkeitstraining die dorsolaterale präfrontale Kortexaktivität erhöht, was auf eine verbesserte Konfliktlösung durch top-down Mechanismen hinweist. Diese Veränderungen sind spezifisch für die Achtsamkeitspraxis und unterscheiden sich von anderen kognitiven Trainingsmethoden (Allen et al., 2012).
Herausforderungen und zukünftige Forschungsrichtungen
- Methodologische Herausforderungen: Die Forschung zu Achtsamkeit und Inquiry steht vor methodologischen Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Definition und Messung dieser Konzepte. Es besteht Bedarf an präziseren Forschungsansätzen, um die spezifischen Mechanismen und Wirkungen von Achtsamkeit und Inquiry besser zu verstehen (Fischer et al., 2017; Gibson, 2019).
- Integration in Bildung und Nachhaltigkeit: Inquiry und Achtsamkeit bieten Potenzial für die Integration in Bildungssysteme und Nachhaltigkeitswissenschaften. Sie fördern alternative, kreative Ansätze zur Problemlösung und können zur Förderung von Wohlbefinden und nachhaltigem Verhalten beitragen (Webster-Wright, 2013; Wamsler et al., 2017).
Achtsamkeit und Inquiry in der Gesamtschau
Achtsamkeit und Inquiry sind tief miteinander verbundene Praktiken, die sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene bedeutende Vorteile bieten können. Die Forschung zeigt, dass diese Praktiken nicht nur zur Stressreduktion und Verbesserung der psychischen Gesundheit beitragen, sondern auch tiefere Einsichten und Verbindungen innerhalb von Gruppen fördern können. Zukünftige Forschung sollte sich auf die methodologische Präzision und die Integration dieser Praktiken in verschiedene gesellschaftliche Kontexte konzentrieren, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
Studien zu Achtsamkeit und Inquiry
Crane, R., Stanley, S., Rooney, M., Bartley, T., Cooper, L., & Mardula, J. (2014). Disciplined Improvisation: Characteristics of Inquiry in Mindfulness-Based Teaching. Mindfulness, 6, 1104 – 1114. https://doi.org/10.1007/s12671-014-0361-8
Webster-Wright, A. (2013). The eye of the storm: a mindful inquiry into reflective practices in higher education. Reflective Practice, 14, 556 – 567. https://doi.org/10.1080/14623943.2013.810618
Fischer, D., Stanszus, L., Geiger, S., Grossman, P., & Schrader, U. (2017). Mindfulness and sustainable consumption: A systematic literature review of research approaches and findings. Journal of Cleaner Production, 162, 544-558. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2017.06.007
Wamsler, C., Brossmann, J., Hendersson, H., Kristjánsdóttir, R., Mcdonald, C., & Scarampi, P. (2017). Mindfulness in sustainability science, practice, and teaching. Sustainability Science, 13, 143 – 162. https://doi.org/10.1007/s11625-017-0428-2
Graham, M., & Lewis, R. (2020). MINDFULNESS, SELF-INQUIRY, AND ARTMAKING. British Journal of Educational Studies, 69, 471 – 492. https://doi.org/10.1080/00071005.2020.1837342
Gibson, J. (2019). Mindfulness, Interoception, and the Body: A Contemporary Perspective. Frontiers in Psychology, 10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02012
Allen, M., Dietz, M., Blair, K., Van Beek, M., Rees, G., Vestergaard-Poulsen, P., Lutz, A., & Roepstorff, A. (2012). Cognitive-Affective Neural Plasticity following Active-Controlled Mindfulness Intervention. The Journal of Neuroscience, 32, 15601 – 15610. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2957-12.2012